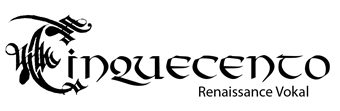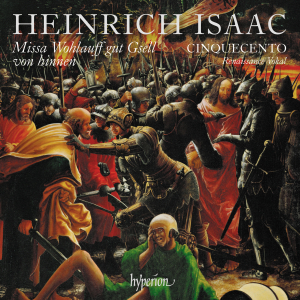
Composers: Heinrich Isaak
Released: 2021
Label: Hyperion, Hyperion records
Code: CDA68337
Description
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.
 English
EnglishHeinrich Isaac (c1450-1517)
Missa Wohlauff gut Gsell von hinnen & other works
Cinquecento 

|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
O decus ecclesiae[12’13]
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Judaea et Jerusalem[6’48]
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
A talent eagerly sought by Lorenzo de’ Medici in Florence and later by Maximilian I in Vienna, Heinrich Isaac enjoyed a distinguished reputation during his lifetime. Listening to these idiomatic accounts from Cinquecento, it’s easy to understand why.
Awards
Reviews
Other recommended albums

Josquin: Motets & Mass movements
CDA68321 Early Choral albums for £8.00Studio Master FLAC & ALAC downloads available

Guerrero: Magnificat, Lamentations & Canciones
CDA68347Studio Master FLAC & ALAC downloads available

CDA68333Studio Master FLAC & ALAC downloads available

CDA68284 Early Choral albums for £8.00Studio Master FLAC & ALAC downloads available
Isaac diente in Florenz als einer der „Sänger von San Giovanni“, die in Messen in den wichtigsten geistlichen Einrichtungen der Stadt auftraten. Obwohl er damit offiziell im Dienst der Kirche stand, ging seine Tätigkeit weit über den rein liturgischen Rahmen hinaus. Die Medici nutzten die Sänger von San Giovanni sowohl für ihre Privatmusik als auch für städtische Repräsentation. Isaacs Schaffen belegt, dass er auch auf diesen Gebieten aktiv war.
In O decus ecclesiae versammeln sich mehrere Aspekte dieser nach mehreren Seiten gerichteten Tätigkeit. Die Dimensionen des Stücks sind außergewöhnlich; es zeigt Isaacs Schaffen von seiner monumentalsten Seite. Den Aufbau bestimmt einer der Grundbausteine der Renaissancemusik: das sogenannte natürliche Hexachord, die Tonfolge C–D–E–F–G–A. In beiden Teilen der Motette baut der Tenor vom tiefsten Ton aus das Hexachord Note für Note auf und wieder ab. Eine pädagogische Absicht ist nicht auszuschließen, wahrscheinlicher aber ist ein symbolischer Gehalt. Vier Stimmen umgeben dieses Grundgerüst, ihr Text preist die Jungfrau Maria in antikisierenden Bildern, ein Zeugnis des Humanismus der florentinischen Renaissance.
Offenbar hatte Lorenzo echte Zuneigung zu Isaac gefasst. Er ebnete ihm den Weg in die florentinische Gesellschaft; Isaac seinerseits komponierte Gedichte seines Mäzens, vielleicht unterrichtete er auch dessen Kinder. Als Lorenzo 1492 starb, gedachte Isaac seiner in mehreren Werken, darunter auch die Motette Quis dabit pacem populo timenti?. Sie folgt einem antiken Vorbild: einem Trauergesang aus der Tragödie Hercules Oetaeus des (Pseudo-) Seneca. Dessen Worte werden um Zusatztexte ergänzt, die ausdrücklich Lorenzo und die Medici-Familie nennen. Das Werk verzichtet auf alles ältere Material, es ist ganz frei gehalten. Seine Gliederung erhält es ausschließlich durch die textliche Ordnung des Seneca-Gesangs und der Zusatztexte: in allen Stimmen machen Kadenzen, Wechsel der Satzweise und Pausen die Zeilen und Halbzeilen unmittelbar deutlich; die musikalischen Motive gewinnen ihren Rhythmus häufig aus den Längen und Kürzen der Worte—ein Verfahren, das in der deutschen Odendichtung des folgenden Jahrhunderts üblich werden sollte.
Mit dem Tod Lorenzos kam das goldene Zeitalter der Stadt unvermittelt an sein Ende. Sein schwacher Sohn und Erbe Piero verlor die Macht und wurde 1494 verbannt. Die Herrschaft übernahm der Dominikanermönch Girolamo Savonarola. Er errichtete eine strenge, asketische Gesetzesordnung, unter der komplexe Musik, wie Isaac sie schrieb, untersagt war. Glücklicherweise waren Musiker von Isaacs Format auch anderweitig begehrt: Ende 1496 erlangte er die Stellung als Hofkomponist des habsburgischen Kaisers Maximilians I. und zog eine Zeitlang nach Wien und Innsbruck. Für Kaiser Maximilian brachte die Einstellung Isaacs einen Prestigegewinn: dessen neue Rolle verschaffte dem Kaiserhof musikalische Weltgeltung. Der Kaiser räumte Isaac ungewöhnlich großzügige Arbeitsbedingungen ein. Nach dem Abklingen der schlimmsten Unruhen durfte er in Florenz bleiben und dem Hof aus der Ferne dienen.
Die Kreise, in denen Isaac am Kaiserhof verkehrte, waren zwar ähnlich vielschichtig wie jene, in denen er sich in Florenz bewegte. Seine Hauptaufgabe jedoch bestand darin, die Hofkapelle mit einem umfassenden liturgischen Repertoire zu versorgen. Ein großer Teil davon bestand in Messkompositionen und Musik für das Messproprium, die auf gregorianischen Gesängen beruhte. Doch auch andere Gattungen spielten eine Rolle. Zu einem frühen Zeitpunkt in seinem kaiserlichen Dienst griff Isaac eine Messe auf, die er in Florenz geschrieben hatte und die auf dem volkstümlichen Lied Comment peult avoir joye? beruhte. Möglicherweise kannte er das Lied in dessen einstimmiger Form; sicher war ihm auch eine polyphone Fassung seines Zeitgenossen und Rivalen Josquin des Prez bekannt, komponiert um 1490 wahrscheinlich in Rom. Der Liedtext beklagt in zeittypischer Weise widerfahrenes Unglück, er ist voller Bilder aus der Hirten- und Naturwelt und enthält auch selbstbezügliche Bemerkungen über die Heilkraft der Musik—oder vielmehr über deren Versagen. In Josquins Fassung erklingt das Lied in strengem Oktavkanon zwischen Cantus und Tenor. Die anderen beiden Stimmen beziehen ihr Material ebenfalls aus der Liedweise. Dadurch entsteht eine Einheitlichkeit der Stimmen untereinander, die es ermöglicht, das Kanon-Gerüst im Satz zu verbergen.
Zwar war der Text zu Comment peult wohl ursprünglich französisch, doch war das Lied auch in Deutschland bekannt, allerdings mit deutschem Text: Wohlauff gut Gsell von hinnen. Solche Umtextierungen, Kontrafakturen genannt, waren im 15. und 16. Jahrhundert ein weit verbreitetes Mittel der Bearbeitung. Vielleicht war es die Entdeckung, dass man die Weise Comment peult auch in Deutschland kannte, die Isaac dazu bewegte, seine florentinische Missa Comment peult umzuarbeiten. In ihrer früheren Gestalt war sie ein recht typisches vierstimmiges Werk. Durchweg tritt die Weise Comment peult deutlich hervor, häufig in der Oberstimme; einige Abschnitten heben sie so sehr melodisch hervor, dass einige Kommentatoren meinten, eigentlich handele es sich um Liedsätze, vor der Messe komponiert und später in sie übernommen. Es gibt keinen Hinweis auf eine übergreifende Ordnung, allerdings stehen manche Abschnitte in strengem Kanonsatz.
Eigentlich gab es keinen Grund für den Kaiserhof, die Messe Comment peult nicht einfach so zu übernehmen, wie sie war. Isaac jedoch beschloss, sie tiefgreifend umzuarbeiten und zu erweitern. Dies umfasste drei Arbeitsgänge: zunächst übernahm er alle Teile der vierstimmigen Messe in die neue Fassung bis auf einen. Zwei dieser Abschnitte blieben in Stellung und Text unverändert, alle übrigen jedoch wurden neu angeordnet und mit anderen Teilen des Messordinariums neu textiert.
Zweitens verteilte Isaac in der umgearbeiteten Fassung das Messordinarium auf bedeutend mehr Abschnitte als zuvor. So schuf er Raum für acht ganz neue Teile. Diese Abschnitte unterscheiden sich von der ursprünglichen Messe darin, dass sie nicht vier Stimmen einsetzen, sondern sechs. Zu Isaacs Zeit bedeutete der sechsstimmige Satz noch eine ganz andere Dimension, er zog das Interesse vieler Komponisten seiner Generation auf sich. Besonders der Kaiserhof zeigte sich daran interessiert; es ist sogar möglich, dass gerade Isaacs Können in dieser Satzart für Kaiser Maximilian den Ausschlag dazu gegeben hatte, ihn an den Hof zu holen.
In einem dritten Schritt schließlich wurden vier Teile der ursprünglichen vierstimmigen Messe erweitert. Zwei davon wurden um neue Abschnitte ergänzt und damit länger; zwei weitere wurden in der Vertikalen erweitert, nämlich um zwei neue Stimmen—eine zweite Ober- und eine zweite Unterstimme—die zum vierstimmigen Original hinzukamen.
So wurde die sechsstimmige Missa Wohlauff gut Gsell von hinnen zu einer der eindrucksvollsten Kompositionen des Messordinariums, die Isaac schuf. Sie zählt zu seinen längsten und klangprächtigsten. Reduzierte Stimmkombinationen erscheinen im Verlauf der Messe in kaleidoskopischer Fülle, und nur im Ausnahmefall wiederholt sich die gleiche Satzart in unmittelbarer Folge. Der Cantus firmus wird unterschiedlichsten Bearbeitungsverfahren unterzogen. Er erscheint nicht nur an jeder denkbaren Position im Satz, sondern wird auch gründlich auf sein Kanonpotenzial hin verarbeitet: als einfacher Kanon in verschiedenen Intervallen, zweimal so, dass sich aus zwei Stimmen vier Kanonstimmen ergeben, als Proportionskanon und, als Höhepunkt im Schlusssatz, zweimal in der Weise, dass sich aus einer Stimmen drei Kanonstimmen ergeben.
Musik, so heißt es, überlebte bis vor nicht allzu langer Zeit ihren Schöpfer in der Regel nicht. Doch wie es mit Gemeinplätzen so ist: die Tatsachen stehen ihnen oft entgegen—zumindest bei Komponisten vom Rang eines Heinrich Isaac. Das bezeugen die vier Motetten, die diese Aufnahme vervollständigen. Sie wurden sämtlich in Quellen aus dem deutschsprachigen Raum überliefert, was dafür spricht, dass sie aus den Jahren stammen, in der Isaac für den Hof Kaiser Maximilians tätig war; und diese Quellen datieren alle aus der Zeit nach Isaacs Tod.
Dabei hat posthume Überlieferung ihre Fallstricke. Oft wurde Musik, die als erhaltenswert galt, in neue Kontexte eingefügt, und erhalten blieb dann nur die umgearbeitete Fassung. Das ist der Fall bei Sive vivamus, dessen Text aus Paulus’ Brief an die Römer stammt. Das Stück wurde auch mit dem Text der marianischen Antiphon Ave regina caelorum überliefert; original ist aber wohl keine der beiden Versionen. Das Stück ist in freier Vierstimmigkeit komponiert. Der ausdrucksvolle phrygische Modus und die tiefe Lage lässt an Trauerkompositionen Isaacs denken, etwa an Quis dabit capiti meo aquam?.
Die übrigen drei Motetten basieren alle auf gregorianischen Cantus firmi. Das üppig gesetzte fünfstimmige Recordare, Jesu Christe blieb nur in einer einzigen Quelle aus den 1560er-Jahren erhalten. Es handelte sich ursprünglich um ein marianisches Offertorium mit dem Text Recordare, virgo mater; im Zusammenhang der Reformation jedoch wurde es lutherischen Gebräuchen angepasst: alle Verweise auf Maria wurde durch solche auf Jesus ersetzt. Der Cantus firmus erklingt im Unterquint-Kanon zwischen Alt und zweitem Tenor. Parce, Domine, populo tuo ist ein kurzer vierstimmiger Satz auf Worte aus dem Buch Joel. Der unbekannte Cantus firmus, hier im Tenor, hat den Charakter eines Psalmtons. Judaea et Jerusalem ist die Komposition eines Responsoriums für die Christmette; der Cantus firmus erklingt in der Bassstimme. Die Zuschreibung an Isaac ist unsicher und schwierig zu klären. Ihre früheste Abschrift erscheint mehr als zehn Jahre nach Isaacs Tod und schreibt sie dessen großem Zeitgenossen Jakob Obrecht zu; spätere Quellen jedoch nennen Isaac als Komponisten. Stiluntersuchungen sprechen in mancher Hinsicht für Obrecht, erlauben jedoch keine endgültige Zuschreibung. Wer immer das Stück geschaffen hat: es ist ein ausgezeichnetes Werk und weist alle Qualitäten erstrangiger liturgischer Musik aus dem frühen 16. Jahrhundert auf. Tief in der Tradition verwurzelt, mit weitgespannten Linien, die sich zu Imitationen und rhetorischen Schwerpunkten verdichten, wird es nicht allein seinem Zweck gerecht, sondern bringt den mystischen Gehalt seines Textes von innen her zum Leuchten.
David J Burn © 2021
Deutsch: Friedrich Sprondel